Förderung von Umsetzungsprojekten
Das Ausbildungspersonal hat eine Schlüsselfunktion bei der betrieblichen Umsetzung einer nachhaltigen Berufsbildung. Mit der ersten Förderrichtlinie des Programms werden Umsetzungsprojekte zu deren Kompetenzstärkung gefördert.

Was wird gefördert?
- Die nachhaltigkeitsbezogene Qualifizierung des Ausbildungspersonals in Betrieben sowie der Lehrkräfte an außer- und überbetrieblichen Bildungseinrichtungen
- Die Etablierung von BBNE-Angeboten in Weiterbildungseinrichtungen durch Integration in das Angebotsportfolio, Durchführung von Train-the-Trainer-Schulungen, Wissenstransfer zwischen Dozent/-innen sowie Marketing- u. Vertriebsmaßnahmen
- Die Schaffung von BBNE-förderlichen Rahmenbedingungen durch Stärkung von BBNE im Prüfungswesen, Auf-/Ausbau von Netzwerken sowie Qualifizierungen für Entscheidungstragende sowie Multiplikator/-innen der Berufsbildung
Wer wird gefördert?
- An 21 Umsetzungsprojekten sind 54 Einrichtungen aus der Berufsbildungspraxis und -wissenschaft direkt beteiligt sowie über 150 assoziierte Praxis- und Strategiepartner.
- Ihr gemeinsames Ziel ist es, insgesamt 12.000 Fachkräfte unterschiedlicher Branchen und Beruf nachhaltigkeitsbezogen zu qualifizieren.
- Dazu setzen sie passgenaue analoge und digitale Bildungsangebote um, die oft modular aufgebaut sind – von niedrigschwelligen Schnupperkursen bis zum umfassenden Zertifikatskurs.

BASINtech: Betriebliche Ausbildung und die Strategische Implementierung von Nachhaltigkeit. Handlungskompetenzen für Ausbilder/innen und Interessensvertretungen in High-Tech Unternehmen

BBNE ECONET: WIR sind BBNE! BBNE-Netzwerk für die deutsche Wirtschaft
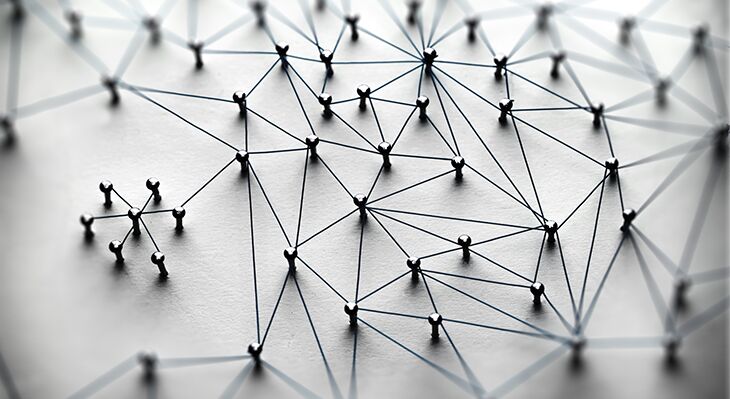
BBNE-Hubs: Regionale Netzwerke zur nachhaltigkeitsorientierten Qualifizierung des beruflichen Aus- und Weiterbildungspersonals

BBNELobby

BBNE-PfleGe: Praxisanleitende in Pflege- und Gesundheitsberufen als Schlüsselpersonen für BBNE

FaME: Fachkraft für nachhaltige Entwicklung Metall- und Elektroberufe
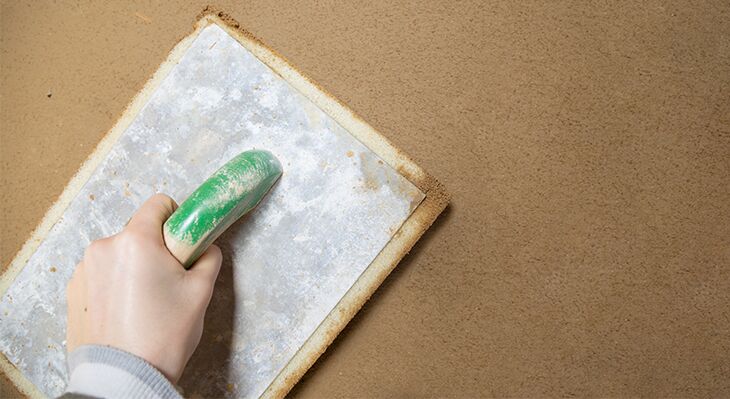
GreenWorks: Lernortkooperation für Klimagewerke und Nachhaltigkeit

HAND: Hauswirtschaftliche Ausbildung nachhaltig denken

LBT_NAH: Nachhaltigkeit in der Ausbildung heute – Zukunftsorientiert und nachhaltig ausbilden im Land- und Baumaschinenmechatroniker-handwerk

MONAMINT: Modern und nachhaltig ausbilden in MINT-Berufen der chemischen Industrie

NABASO: Nachhaltig ausbilden im Bau- und Sozialwesen

NachBau: Nachhaltigkeit in der Bauausbildung verankern – Qualifizierung und Kompetenzentwicklung des ausbildenden Personals in ÜBS der Bauwirtschaft zur Implementierung der Standardberufsbildposition Umweltschutz und Nachhaltigkeit

NachhaltigH2: Nachhaltigkeit in der bisherigen Berufspraxis und neue Aufgabenfelder im Bereich Wasserstofftechnik als Anforderungen an den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker/-in

Naht: Nachhaltiges Handeln in der pflegeberuflichen Bildung

NaLoGo: Nachhaltigkeit in der Logistik am Beispiel der Gestaltung und Organisation von Lieferketten und E-Mobilität

NaVeBb: Nachhaltigkeit in Versicherungs- und Beratungsberufen

NAWiGaLa: Qualifizierung für Nachhaltiges Ausbilden und Wirtschaften im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau

NBAU: Nachhaltig im Bau - Train-the-Trainer Schulungen und Community Building für eine berufliche Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Bauwirtschaft in Berlin-Brandenburg

NIBTEX: Nachhaltig im Beruf - Etablierung von Qualifizierungsmaßnahmen für das Lehr- und ausbildende Personal in der Textilindustrie
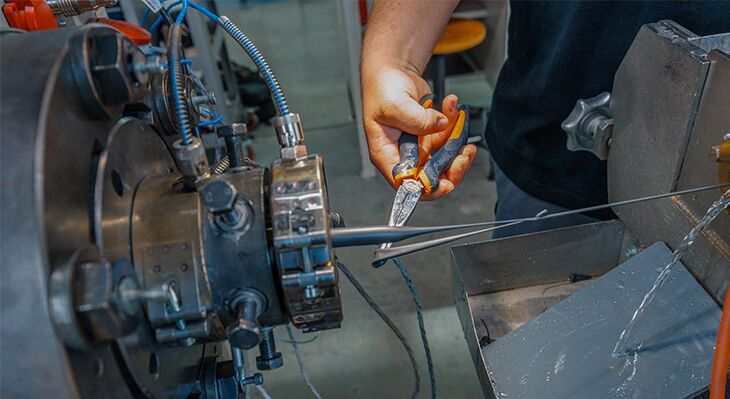
NiME: Nachhaltigkeit in der Metall- und Elektroindustrie

ZBN: Zukunftsorientierte Berufsausbildung – Nachhaltigkeit in der Ausbildung verankern durch spielbasierte digitale Bildungswerkzeuge
